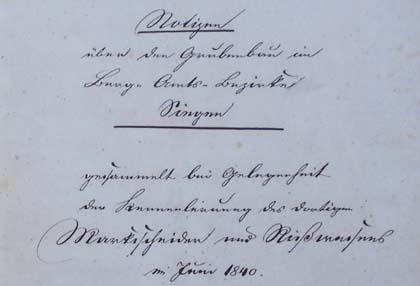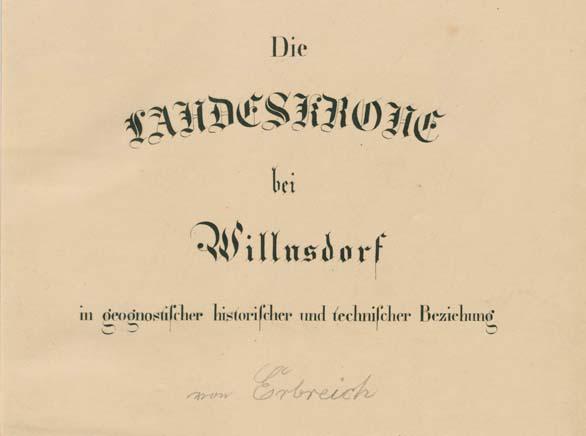
Der beim Königlichen Bergamt in Siegen als Bergamtsobereinfahrer beschäftigte Bergmeister Leonhardt Erbreich erstellte im Mai 1841 das 150 Seiten lange, später vielfach zitierte Gutachten „Die Landeskrone bei Willnsdorf in geognostischer, historischer und technischer Beziehung“.
Das Titelblatt des Gutachtens zeigt eine Zeichnung des oberirdischen Grubengeländes, dem Gutachent beigefügt sind Risswerke des Gangverhaltens, der Setzwäsche und der baulichen und technischen Anlagen des Grubengebäudes.
Die Landeskrone bei Wilnsdorf von Erbreich (Titelblatt)
Gangverhalten Grube Landeskrone 1
Grundriss Landeskroner Setzwäsche
Grundriss Grubengebäude Landeskrone
Grundriss Aufbereitungs-Anstalt Landeskrone
Bildnachweis: GStA PK I. HA, Rep. 121, Nr. 6958
Siehe auch: Karte der preußischen Uraufnahme von 1842